Laudate Dominum, quoniam bonus —
Ps. CXLVI (147)
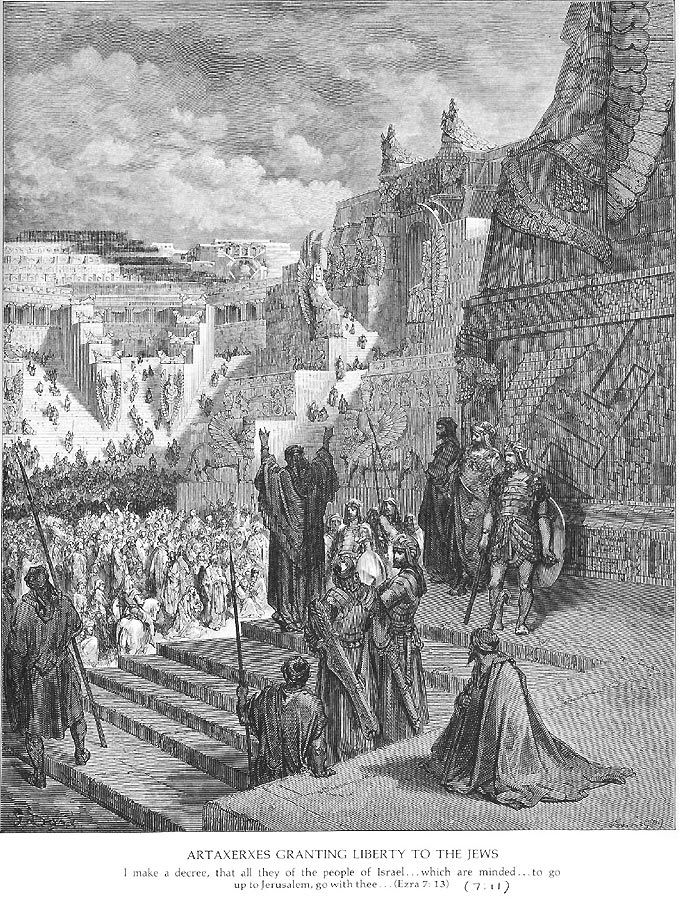
„Der Herr baut Jerusalem wieder auf und sammelt die Zerstreuten Israels“. (147; 2)
Hier findet die Zählung der beiden Traditionen durch Aufteilung des (hebr.) Psalms 147 in die beiden Teile CXLVI und CXLVII in der Septuaginta wieder zusammen. Der sprachlichen Gestalt nach möchte man hier der von der Septuaginta vorgegebenen und von der Vulgata übernommenen Einteilung in zwei Lieder folgen. Vers 146/11 klingt doch stark wie ein Schlußvers, und die ersten Verse von 147 hören sich nicht nur wegen des einleitenden „Alleluja – lauda“ wie der Beginn eines neuen Liedes an.
Schaut man mehr auf den Inhalt, so tritt das Gemeinsame und damit die Einheit der beiden Teile stärker in de Vordergrund. Beide Psalmen bzw. Psalmteile sind nach dem gleichen Schema aufgebaut: Eine erste Strophe enthält die Aufforderung zum Gotteslob, um sich dann im folgenden Vers dem eigentlichen Thema „Jerusalem“ zuzuwenden. In 146 ; 2, 3 geht es um den Wieraufbau und die Rückkehr der zerstreuten Bewohner; in 147 / 2, 3 um die Befestigung und Friedenssicherung der wiedergewonnenen Stadt. Die jeweils folgenden Verse besingen dann die Großtaten Gottes an den Menschen und seiner Schöpfung in allgemeingültigen und überzeitlichen Bildern – von der kosmischen Ebene der Erschaffung der Gestirne (146; 4) bis zur irdischen Ebene in seiner Herrschaft über das Wetter (147; 6,7). Beide Teile schließen dann mit einer leicht unterschiedlich akzentuierten Heilszusage: 146;11 gilt „allen, die ihn fürchten und auf ihn hoffen“ – womit Israel besonders angesprochen ist, aber andere nicht ausgeschlossen werden. Die Parallelstelle in von 147; 8,9 spricht dagegen das auserwählte Volk speziell an und betont seine Sonderstellung: „An anderen Völkern hat er so nicht gehandelt“.
Der Befund dieser Parallelführung läßt es durchaus denkbar erscheinen, daß die (nach der Septuaginta) zwei Psalmen tatsächlich zwei Teile oder zwei komplex aufgebaute Strophen ein- und desselben Psalms darstellen, deren Zusammengehörigkeit in der Tradition der alexandrinischen Juden irgendwann verloren gegangen war. Inhaltliche Unterschiede oder gar Differenzen lassen sich daraus nicht ableiten.
Beide Psalmen oder Psalmteile enthalten aber noch je ein inhaltlich irritierendes Element. In 146, 10 wird betont, daß der Herr kein Wohlgefallen am schnellen Lauf des Mannes oder der Kraft des Pferdes habe. Das ist – soweit unsere begrenzten Kenntnisse reichen – eine für das Alte Testament durchaus ungewöhnliche Aussage. Jahweh schätzt die Frömmigkeit und Gesetzestreue, auch gute Werke gegenüber den Mitmenschen oder im rechten Geist dargebrachte Opfer – aber das Wohlgefallen der Gottheit an Pferdekräften oder starken Ringkämpfern ist eher eine Sache griechischer und noch weiter nördlich wohnender Götter. Tatsächlich waren die olympischen Spiele ihren Ursprüngen nach ja eine Art Gottesdienst, eine Leistungsschau zu Ehren der Götter. Von daher ist es vermutlich nicht unberechtigt, in dieser Feststellung von 146; 10 vor allem eine Absage an ins Judentum einströmenden hellenistische Vorstellungen zu sehen. Was eine entsprechend späte Datierung voraussetzt.
Einen zweiten Stolperstein bietet 147; 4 und 7, wo zweimal vom „Wort Gottes“ die Rede ist. Hier haben wir es mit einer der „prophetischen Ambivalenzen“ der biblischen Sprache zu tun, die notwendiger weise von Juden und Christen unterschiedlich verstanden werden mußten. Im Weltbild der Psalmen ist das „Wort Gottes“ Ursache und Beweger der ganzen Schöpfung. Und die Wettererscheinungen sind eng verwandt mit den Engeln, die Gottes Wort vollziehen (Ps. 148; 8). Aber erst in der Offenbarung des neuen Testamentes wird dieses Wort Gottes zur göttlichen Person und dem Salvator mundi, der die in der Kälte erstarrten Wasser der Welt (147; 7) schmelzen läßt und die Welt wieder in Stand setzt, so zu werden oder sich zumindest dem wieder anzunähern, wie sie ursprünglich sein sollte. Erst aus dieser Perspektive ist die in beiden Abschnitten des Psalms vorgetragene Schilderung der Wohltaten Jahwes – das ist: Christus – in ihrem vollen Umfang zu erschließen.
Letzte Bearbeitung: 22. April 2024
*