Quare fremuerunt gentes — Ps. II
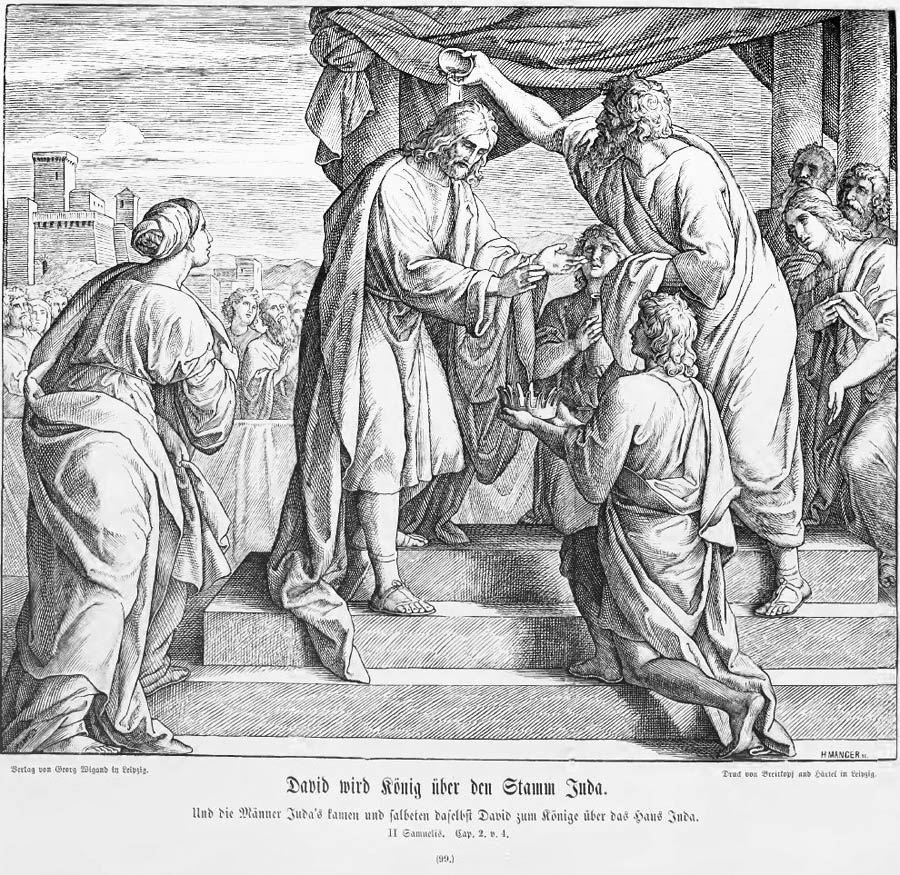
„Ich selber habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berg.“ (2; 6)
So einfach sich Psalm 1 aus unserer (durchaus begrenzten Perspekte und Zielsetzung) darstellte, so kompliziert wird es bereits bei #2, in dem verschiedene historische, textliche, literarische und spirituelle Ebenen einander überlagern.
Die Probleme beginnen schon bei der Zählung: Nach der Apostelgeschichte (13,33) wurde dieser Psalm von deren Verfasser als der erste gezählt, und es ist nicht ganz klar, ob der heutige #1 als Vorwort ungezählt davor stand oder mit zu diesem gerechnet wurde. Diese Art von Problemen wird noch mehrfach vorkommen, und wir befreien uns davon in der Weise, daß wir stets der Zählung und Einteilung von Septuaginta und Vulgata folgen, wie es der Tradition der Kirche des Ostens wie im Westen entspricht. Differenzen zu anderen Zählungen – namentlich der von Reformatoren und Reformisten bevorzugten Zählung des nachchristlichen Judentums – werden wir nur da beachten, wo daraus ein Erkenntnisgewinn abzuleiten zu sein scheint.
Psalm 2 also beginnt mit der Beschreibung eines durchaus chaotischen Weltzustandes (1-5) geht dann über zu einer feierlichen Proklamation eines als Gottessohn angesprochenen Weltenkönigs (6-9) und endet mit einem Appell an die Gewaltigen der Erde (die zuvor als Aufständische benannt worden waren), sich der Autorität dieses Königs zu fügen.
Die Königsproklamation ist nicht nur von ihrer Stellung im Text her das Zentrum dieses Liedes. Sie geht vermutlich auf sehr alte Elemente zurück, die vermutlich aus der Liturgie der Thronbesteigung der Königszeit stammen. Sie konnte von den Juden auch nach Verlust des Königtums und des Tempels 587 als Erinnerung an eine glorreiche Vergangenheit und als Vorausschau auf eine künftige Wiedergeburt des alten Reiches in Gottesdiensten und im persönlichen Gebet weitergeführt werden. Den frühen Christen fiel es leicht, hier anzuknüpfen, da für sie der Messias ja bereits gekommen war und sich sowohl zum Sohn Gottes erklärt als auch zum König der Schöpfung proklamiert hatte. Von diesem messianischen Verständnis her, das Juden und Christen trotz der unterschiedlichen Blickrichtung gemeinsam war, ergab sich auch die Einordnung der Einleitungs- und der Schlußverse wie von selbst.
Und das ist auch für den christlichen Beter der Gegenwart kein Problem, sondern unmittelbar einsichtig. Das Toben der Heiden und der Aufstand der Gottlosen ist in unseren Tagen so deutlich – vielleicht sogar noch deutlicher – wahrnehmbar als zur Entstehungszeit dieses Psalms, und daß die Anerkennung der Herrschaft Gottes und seines Gesetzes der einzige Weg zur Rettung ist, und zwar nicht nur für die Könige und Herrscher, sondern für alle Menschen, steht ebenso außer Frage. In seinem großen Bogen ist Psalm 2 daher ein Gebet von bestürzender Gegenwärtigkeit.
Damit kann es für viele Beter auch sein Bewenden haben, ohne daß das ihrer Frömmigkeit Abbruch täte. Aber bei genauerem Hinsehen zeigen sich innerhalb des großen Bogens ein Fülle von Problemen, die tiefergehende Fragen aufwerfen und oft auch zu tiefer gehenden Einsichten führen. Im ersten Teil sind das besonders die letzten Verse, in denen vom Zorn Gottes die Rede ist und seinem Spott über die Geschöpfe, die sich gegen ihn erheben. Wenn man vom Lokal- oder besser dem Temporalkolorit dieser Worte absieht, bleibt doch der Eindruck von der tiefen Kluft bestehen, die den Schöpfer von seinen Geschöpfen trennt. Und gleichzeitig wird der Blick darauf gelenkt, daß in Christus diese Kluft überbrückt worden ist und daß neben dem Zorn Gottes auch die Liebe zu seinen Geschöpfen Bestandteil des Gesamtbildes sein muß. Genau dieser Gedanke wird dann ja auch im Schlussteil aufgenommen und weiter geführt – bis hin zu dem Erlösungsversprechen der letzten Zeile: Heil allen, die zu ihm flüchten.
Eine Fülle von sprachlichen, historischen und konzeptionellen Problemen enthält der Mittelteil – gut geführte theologische Bibliotheken enthalten alleine dazu viele laufende Meter Literatur. Zwei Einzelprobleme daraus sollen hier ein wenig näher betraxchtet werden, weil sie Aufschlüsse darüber geben, wie die Psalmen (und die Schriften des AT überhaupt) aus ihrer in vielem noch sehr unerleuchteten und unerlösten Umwelt hervorgegangen sind und schließlich prophetischen Charakter annehmen konnten.
Die Zeilen 7-9 (sie bilden nebenbei bemerkt die dritte Strophe des aus vier dreiversigen Strophen bestehenden Liedes) können als Auszug aus dem Proklamationsgesang des Königs gelesen werden, mit der er dem Volk den ihm erteilten göttlichen Auftrag mitteilt. Darin findet sich nichts Individuelles für einie bestimmte Person oder auch nur für den König Israels: Bis in die Formulierungen hinein ähnliche Sätze sind aus den Reden überliefert, mit denen die Gottkönige anderer Völker des alten Orients von Ägypten bis ins Hethiterreich ihre Thronbesteigung verkündeten. Das „mein Sohn bist Du, heute habe ich Dich gezeugt“ ist eine Adoptions- uind Anerkennungsformel, mit der Väter – und insbesondere natürlich Könige – ihren (Lieblings)Sohn (von der Lieblingsfrau) als legitimen Erben anerkannten und zum Nachfolger einsetzten. Die Rede des Göttervaters „ich gebe dir zum Besitz die Enden der Welt“ hatte in den Großreichen des alten Orients durchaus einigen Realitätsgehalt – im Zwergstaat Juda kann sie von Anfang an nur metaphorisch verstanden worden sein. Ebenso gehören das „Herrschen mit eisernem Szepter“ und das „Zerschlagen wie Töpfergeschirr“ zu den Beschreibungen der Königsmacht, die etwa aus Ägypten auch in bildlichen Darstellungen überliefert sind.
Das Bild des Königs, von dem hier die Rede ist, geht einerseits unverkennbar aus der materiellen und geistigen Lebenswelt der Zeit hervor, um diese Ebene andererseits zu übersteigen und wahrhaft zu transzendieren. Das Verständnis dieses Prozesses, dieses Aufsteigens aus irdischer Rohheit zur Offenbarung der Übernatur und des Himmels ist unerläßlich zum Verständnis der Psalmen. Gott hat seine Offenbarung nicht als Donnerschlag vom Himmel herabgeschleudert, sondern ihr über die Jahrhunderte hinweg in Seinem Volk Israel einen aufnahmebreiten Boden bereitet. Die Psalmen, die wie ein Konzentrat fast alle wesentlichen Aussagen des Alten Testaments in sich vereinen, sind das wirkmächtigste Zeugnis dieses Prozesses – bis in die Gegenwart hinein. Nur auf dem so vorbereiteten Boden konnte Maria ihr „fiat“ sprechen, und nur auf diesem Boden konnte sich der Glaube an Jesus den Messias so ausbreiten, wie das geschehen ist. Allerdings sind auf diesem Boden dann auch Irrtümer und Mißverständnisse gewachsen – die Leugner der Göttlichkeit des Sohnes von Anbeginn wie die Vertreter des Adoptionismus beriefen sich auf ihrerzeit geläufige Interpretationen von Psalm 2,7.
Manche Interpretationen weichen auch deshalb voneinander ab, weil es Unsicherheiten in der Textüberlieferung gibt. Psalm 2 enthält in Vers 11 ein Prachtexemplar einer solchen Unsicherheit. Der überlieferte Text bietet da sowohl im Hebräischen als auch griechisch und lateinisch eine Wendung, die man wörtlich als „jubelt ihm zu mit Zittern und Zagen“ übersetzen muß. So steht es denn auch in älteren katholischen und auch orthodoxen Psalmenübersetzungen; auch die jüdische Übersetzung von Naftali Herz schreibt: „Preist den Herrn mit Schauern“. Die protestantische Bibelwissenschaft war nun jedoch der Meinung, daß „eine solche Zusammenstellung zweier entgegengesetzter Gemütszustände für die Denkweise Israels ganz unmöglich“ (Gunkel) gewesen sei und „verbessert“ den Text im Hebräischen so, daß man übersetzen kann: „küsset ihm zitternd die Füße“. So hat es denn auch die Einheitsübersetzung von 1980. Der Leser der revidierten Version von 2016 findet dort zu seinem Erstaunen die Wendung „küsst den Sohn“ – und das zumindest in den üblichen Ausgaben ohne den geringsten Hinweis darauf, daß hier etwas geändert wurde und warum.
Der Grund ist ganz einfach: Es gibt tatsächlich eine syrisch-aramäische Version des AT, in der in Vers 11 vom Sohn die Rede ist. Und da auch die Textkritik ihre Moden hat, wurden nun an Stelle der weitgehend aus der Luft gegriffenen Füße der immerhin aus älterer Zeit belegte Sohn eingefügt. Inhaltlich macht das an dieser Stelle keinen großen Unterschied: Das Küssen des Sohnes ist ebenfalls ein Unterwerfungsgestus, der die Loyalität nicht nur gegenüber dem aktuellen Amtsinhaber, sondern auch der nächsten Generation des Herrscherhauses verspricht. Es gibt jedoch auch ganz ähnlich gelagerte Fälle textlicher Unsicherheit – in Psalm 22,17 wird uns ein krasses Beispiel begegnen – die sehr wohl von großer inhaltlicher Bedeutung sind.
Den Psalm als Huldigung an Christus den Weltenherrscher zu lesen, dürfte dem heutigen Beter, wenn er auch nur einige der hier angedeuteten historischen Einordnungen vornimmt, keine großen Schwierigkeiten bereiten.
Letzte Bearbeitung: 20. März 2024
*