Nonne Deo subjecta — Ps. LXI (62)
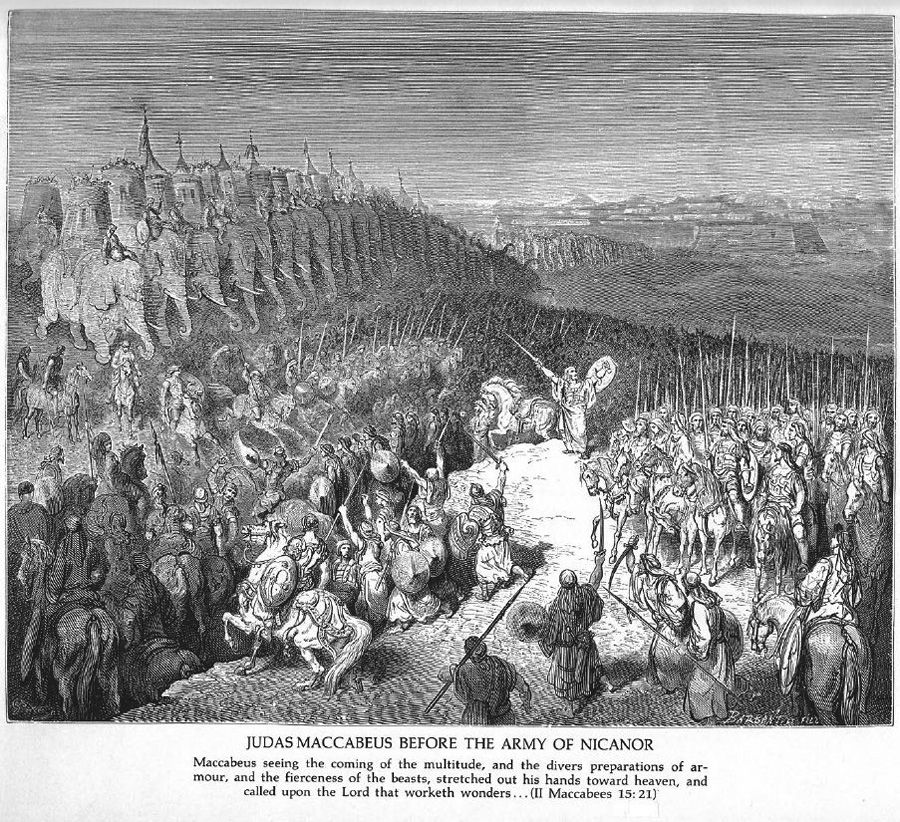
„Bei Gott allein kommt meine Seele zur Ruhe, von ihm kommt mir Hilfe“ (61; 1).
Psalm 60 war schon schwierig – Psalm 61 ist noch schwieriger, und das insbesondere für diejenigen, die ihn in einer (vermeintlichen) Originalsprachen lesen wollen. In jeder sprachlichen Fassung kommen schwer- bis unverständliche Zeilen vor, und anders als bei manchen anderen schwierigen Psalmen ist es bei # 61 kaum möglich, Textprobleme der einen Version mit Blick auf eine andere etwas aufzuhellen. Man muß wohl davon ausgehen, daß schon die von den Übersetzern der Septuaginta benutzte hebräische Vorlage – die uns unbekannt ist und sicher nicht den gleichen Text hatte wie die spätere masoretische Fassung – unverständliche Passagen enthielt.
Bei einer solchen Vermutung stellt sich natürlich die Frage, wie es denn dazu kommen konnte, daß in einer Kultur wie der jüdischen, die ihren heiligen Schriften so hohen Wert beimaß und und eifersüchtig um deren fehlerlose Überlieferung bedacht war, Texte in eine so schlechten Zustand gerieten und dann auch so kanonisiert wurden. Zum ersten Teil der Frage kann man vierlei Spekulationen anstellen, bei denen z.B. die Unterschiede zwischen verschiedenen Dialekten (eher regional bestimmt) und Soziolekten (berufs- oder standesspezifisch) einer Sprache eine Rolle spielen konnten. Es muß immer wieder vorgekommen sein, daß ein Hörer etwas anderers hörte/wahrnahm als das, was der Sprecher gesagt hatte oder sagen wollte. In normalen Situationen konnten solche Probleme erkannt und im Lehrgespräch ausgeräumt werden. Aber im alten Orient gab es viele unnormale Situationen, in denen durch Krieg und Völkermord Traditionsstränge unheilbar beschädigt werden konnten.
Wenn aber ein Text einmal – und sei es auch in korrumpierter und schwer verständlicher Form – z.B. durch liturgischen Gebrauch – geheiligt war, konnte er kaum noch in Frage gestellt und korrigiert werden – und mit fortschreitender Verschriftlichung der Überlieferung umso weniger. Dann konnte das den Betern vertraute Klangbild der Wörter wichtiger werden als die exakte Bedeutung – mit unabsehbaren Folgen für das analytisch-wörtliche Verständnis von Texten. Wir tun vermutlich weder den Juden des Alten Testaments noch den Christen der frühen Zeit – die in manchen Gegenden bis ins Mittelalter dauerte – Unrecht, wenn wir ihnen unterstellen, daß sie nicht alle Gebete wörtlich verstanden und nachvollzogen, sondern ihr Gebet eher an überlieferten Situationen, Haltungen oder Stimmungen orientierten. Das heute sogenannte „Bibelhebräisch“ war schon für die Juden der Zeit Christi eine Fremdsprache. Und für den einen oder anderen Psalmvers mögen auch die Rettungsversuche der masoretischen Schriftgelehrten in der Spätantike zu spät gekommen sein.
Aber nach dieser Einleitung zunächst zu den Versen, deren Verständnis sich ungefähr erschließen läßt. Der Psalm wird eingeleitet durch ein Vertrauensbekenntnis zu Gott in den Versen 2 , 3, das dann in leicht veränderter Form 6, 7 wiederholt wird. Das deutet auf eine Gliederung in zwei (ungleich lange) Teile hin und gibt schon einmal einen bestimmten Rahmen. Im ersten Teil folgt dem Vertrauensbekenntnis die Schilderung einer bedrohlichen Situation, von deren Einzelheiten einiges unklar bleibt. Von allen Seiten stürmen die Feinde gegen einen hochgestellten Menschen an, der – nach der griechischen Tradition – schon zu fallen scheint - wie eine einstürzende Stadtmauer. Die heute meistgenutzte hebräische Version spricht zwar auch vom Ansturm gegen einen „Mann“ – sieht aber letztlich dessen Feinde zugrunde gehen wie einstürzende Mauern. Dann geht es im Kampfgetümmel auf hebräischer und griechischer Seite mit unterschiedlichen Bildern und Assoziationen weiter, erst im letzten Halbvers von 5 finden die Versionen wieder zusammen: „Heuchlerisch segnen sie mit dem Mund, doch innerlich verfluchen sie“.
Betrachtet man die Verse 4 und 5 in dieser eher abstrakten Weise, wird erkennbar, daß es auf die konkrete Wortbedeutung hier auch gar nicht so sehr ankommt: Die „Bösen“ haben sich gegen einen „Guten“ zusammengerottet und versuchen mit allen Mitteln, mit Waffengewalt, Verleumdung und wohl auch Magie, die Oberhand zu gewinnen. Wer will, mag hier einen Anklang an Psalm zwei und die gegen den Herrn heranstürmenden „Großen der Erde“ vernehmen – allerdings ist der Angegriffene in Psalm 2 eher Gott im Himmel selbst oder der von ihm eingesetzte Gottkönig, während in 61 ganz klar von einem „Menschen“ „wie Du und ich“ , einem Vater, Sohn oder Ehemann die Rede ist – im Hebräischen von ‚ish‘, griechisch von ‚anthropos‘, lateinisch von ‚homo‘. Da stimmen also die Versionen voll überein – eine „messianische“ Deutung der Stelle wäre demnach eher nicht angebracht – aber vielleicht ein Blick auf David, an den und dessen vielfältige Kämpfe und Notsituationen die jüdischen Beter sicher auch dann gedacht hätten, wenn sein Name nicht in der wie üblich nicht verifizierbaren Weise in der Überschrift genannt wäre. Und natürlich war David für die christlichen Beter auch wieder ein Typos Christi. Zur Erklärung zu unpräzise?
Es gibt zwar einige Psalmen, die den Charakter von Lehrgedichten haben und nachgerade „katechismuswürdig“ sind. Andere – wohl die Mehrheit – sind poetische Sprachgemälde, die eher eine Bedeutungswolke erzeugen, die den Geist der Beter in eine bestimmte Richtung lenkt, ohne Details auszubuchstabieren. Das „ausbuchstabieren“ bleibt den Erklärern, Schriftgelehrten wie Kirchenvätern vorbehalten, die sich dabei oft weit von der konkreten Aussage einzelner Verse oder Zeilen gelöst haben und mit assoziativer Verknüpfung dann zu ihren durchaus katechismusartigen Erklärstücken überleiten.
Der erste Teil von Psalm 61 beschränkt sich nach der griechischen Lesart allein auf die Schilderung der Angriffswut der Bösen, während die von Naftali Herz und anderen bevorzugte Version des hebräischen Textes die Angreifer bereits von den einstürzenden Mauern erschlagen sieht. Nach der Wiederholung des Vertrauensbekenntnisses in den Versen 6 und 7 kehren beide Versionen nicht mehr zu dieses Übeltätern zurück, sondern vertiefen und verallgemeinern das Vertrauensbekenntnis von der bis dahin eingehalten Ich-Form des Beters zu einem Appell an das ganze gläubige Volk, sein Vertrauen unerschütterlich auf Gott zu setzen. Dieser Text verfällt dabei in den für die sogenannte Weisheitsdichtung typischen Tonfall, der eingängige Bilder „Nur ein Hauch sind die Menschen“ mit direkten Apellen zu gottgefälligem Verhalten verbindet „Vertraut nicht auf Gewalt, verlasst euch nicht auf Raub!“. Man muß wohl davon ausgehen, daß solche Aufforderungen nicht nur bildhafte Sprachen, sondern auch Ausdruck der realen Lebensverhältnisse vieler Menschen waren: Gewalt und Raub als ständige Bedrohung des Alltags.
Zum Tonfall der Weisheitsdichtung gehört auch die Vers 12 einleitende FormelEinmal hat Gott es ausgesprochen, zweimal habe ich es gehört“, zu deren Herkunft und Bedeutung es verschiedene Erklärungen gibt. Bei solchen Formeln und Redewendungen ist eine analytische Erklärung u. E. Nicht unbedingt zielführend – es reicht die Feststellung der Funktion als Stilmittel: Die Formel stellt – möglicherweise unter Rückgriff auf uralte zahlenmagische Vorstellungen eine direkte Verbindung zwischen dem Spender und dem Verkünder göttlicher Weisheit her und und verleiht dadurch der folgenden Aussage besonderes Gewicht. Und was hier verkündet wird, ist nichts geringeres als das alttestamentarische „Grunddogma“ vom Tun-Ergehens-Zusammenhang: „Gott ist der Mächtige, Gott ist der Barmherzige, und Du – der Satz wechselt mitten im Vers von der Rede über Gott in der dritten zur Anrede in der zweiten Person – und Du wirst jedem vergelten, wie es seinem Tun entspricht.“
Es hat sich seit Jahrzehnten eingebürgeret, dieses hier ausgesprochene Grunddogma als etwas typisch alttestamentarisch-jüdisches zu verstehen, das durch das Christentum irgendwie „überwunden“ worden wäre. Von der „Drohbotschaft“ zur „Frohbotschaft“. Das trifft so nicht zu. Das alte Judentum erwartete entsprechend seiner wenig ausgebildeten Vorstellung vom Leben nach dem Tode die Vergeltung vorzugsweise bereits im Diesseits – war jedoch nicht völlig blind gegenüber der Tatsache, daß gerade die schlimmsten Übeltäter oft als hochangesehene Figuren in goldenen Betten aus deiser Welt dahinscheiden (Ps. 16, 14) und litt unter diesem Widerspruch. Die Auflösung dieser „kognitiven Dissonanz“ gelang erst durch die Botschaft Christi, der im Gleichnis vom reichen Prasser und dem armen Lazarus (Lukas 16, 19-31) die verdiente Vergeltung des Geizlings erst im Jenseits sichtbar werden läßt – und dafür ausgerechnet den Stammvater Abraham, quasi den Begründer der Lehre vom Tun-Ergehens-Zusammenhang, als Zeugen aufruft.
Die zweiteilige Form dieses Psalm, wobei die Teilung noch durch die refrainartig eingesetzten Verse 1-2 und 6-7 hervorgehoben wird, kann ähnlich wie schon bei Psalm 60 die Vermutung wecken, daß hier vielleicht eine liturgische Form vorliegt oder nachgeahmt wird. Ein Gruppengebet, in dem chorische Teile und lehrhafter Vortrag einander abwechseln, am Ende vielleicht abgeschlossen durch den Spruch eines Priesters oder Sehers. Das könnte einige Elemente im dramatischen Ablauf des Gedichtes und vielleicht auch die Schwierigkeiten bei der Textgestalt etwas leichter verständlich machen – aber mehr als eine Vermutung ist das beim nach wie vor niedrigen Stand der Kenntnis über die gottesdienstliche Praxis in Synagoge und Tempel in der Zeit zur Abfassung des Psalters nicht.
Für den christlichen Beter enthält dieser Psalm neben dem Anstoß zum Nachdenken über diesen niemals außer Kraft gesetzten Grundsatz der göttlichen Gerechtigkeit vor allem den Aufruf, Gottvertrauen vor Selbstvertrauen zu stellen, nicht alles für mit eigener Kraft machbar zu halten und dementsprechend das „freie und selbstbestimmte Leben“ so einzurichten, „als ob es Gott nicht gäbe“.
Letzte Bearbeitung: 11. April 2024
*