Ad Dominum — Ps. CXIX. (120)
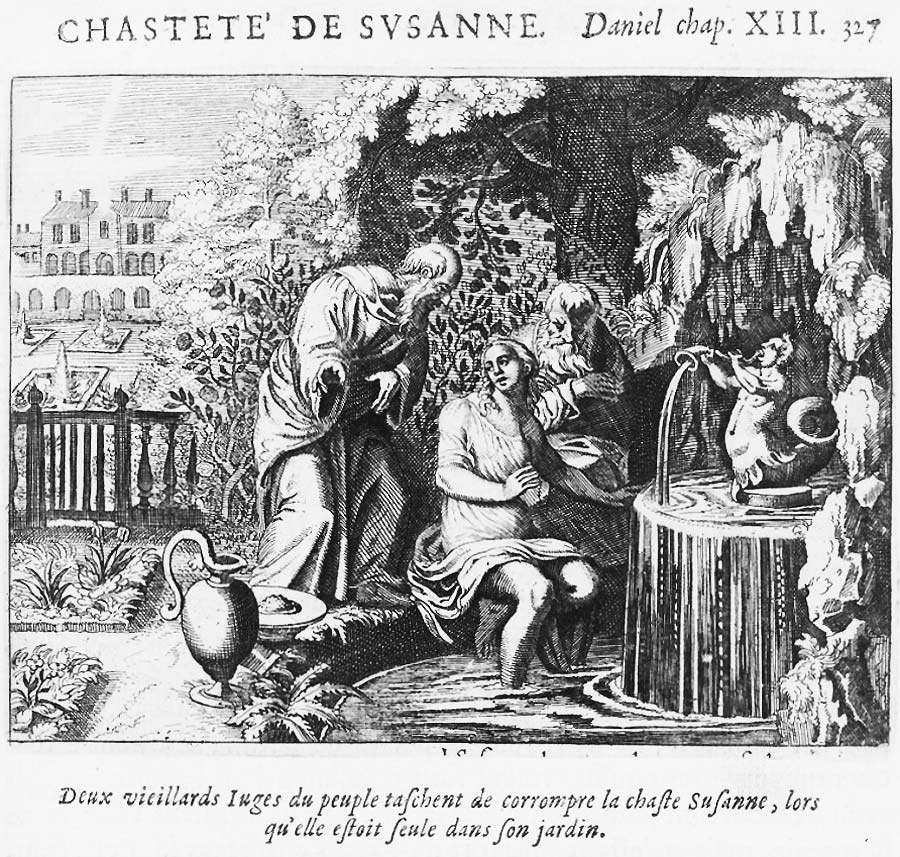
„Herr, rete mein Leben vor Lügnern, rette es vor falschen Zungen“ (119; 2)
Mit diesem Psalm beginnt eine Reihe von 15 Psalmen, die im hebräischen Text die Überschrift: „Ein Wallfahrtslied“ tragen, während in der Vulgata „Canticum gradium“ steht – was oft mit „Stufenlied“ übersetzt wird: Zu singen an den Stufen (des Tempels). Das kann aber auch „Lied der Schreitenden“ heißen, im Griechischen steht „Lied der Hinaufgehenden“. Je genauer man hinschaut, desto kleiner wird der Unterschied. Das gilt auch hinsichtlich des Ortes: Warum sollten nicht die Wallfahrer beim Hinaufsteigen der zahlreichen Treppen und Stufen des Tempels die gleichen Lieder singen wie bereits während der Pilgerfahrt? Und die Bewohner von Jerusalem, die ja nicht wallfahrten mußten, um zum Tempel zu kommen, ebenso?
Allen 15 Psalmen dieser Reihe ist gemeinsam, daß sie außerordentlich kurz sind. Sie haben zwischen 4 und 8 Verse; nur Nr. 131 mit 18 Versen fällt aus der Reihe. Eine weitere Gemeinsamkeit besteht darin, daß sie inhaltlich – wieder mit Ausnahme von Nr. 131 – eher schlicht sind und sich auf den Ausdruck jeweils eines Gedankens, eines Ausdrucks, einer Situation beschränken. Hier mag zutreffen, was wir hinsichtlich der Mehrzahl der anderen Psalmen eher bezweifeln: Daß auch die nicht schriftkundigen „einfachen Leute“ diese Lieder auswendig kannten und sie vielleicht nicht nur zur Wallfahrt, sondern im Alltag fast wie Volks- (oder Kirchen-!)lieder oft und gerne gesungen haben.
Nr. 119 als der erste in der Reihe bringt ein Gefühl zum Ausdruck, das wohl viele Juden – vor allem die, die außerhalb des kleinen geschlossenen Siedlungsgebietes um Jerusalem lebten – nur allzu gut kannten: Diskriminierungserfahrung, wie man heute dazu sagen würde. Der erste Teil ( 1 – 4) des Liedes hat die Form eines Gebetes, mit dem der unter einer feindseligen Umwelt leidende Fromme Gott um Schutz vor den Verleumdungen und Benachteiligungen anfleht. Es beginnt mit einer Formel, die die Gewissheit der Erhörung zum Ausdruck bringt – und es endet mit einer kräftigen Verwünschung, mit der der Beter Gottes Strafen auf die Verleumder herabruft. Die „Ginsterkohlen“ betreffen eine waffentechnische Einzelheit: Brandpfeile mit glühenden Ginsterkohlen waren auch nach einem längeren Flug noch heiß genug, um getroffene Ziele in Brand zu setzen.
Der zweite Teil schildert ein Detail aus der feindlichen Umwelt, in der der Beter „als Fremder“ wohnen muß. Die Ortsnamen werden oft einem Ort Meski in Nordost-Anatolien bzw. dem Nomadenstamm der Kedar in der arabischen Wüste zugeordnet – für die gewöhnlichen Israeliten wohl die fernste Fremde, von der sie jemals gehört hatten, und sicher eine äußerst unangenehme Vorstellung. Sobald sie auch nur den Mund aufmachen, werden sie dort als Fremde erkannt und abgelehnt, oft genug sogar recht handfest.
Mit dieser bedrückenden Schilderung endet der Psalm denn auch schon. Offensichtlich beschreibt er eine Situation aus dem Alltagsleben von Juden, die irgendwo an der Peripherie der jüdischen Welt wohnten und die sich nur gelegentlich dazu aufmachen konnten, den Tempel ihres Gottes im fernen Zion zu besuchen. Ein Wallfahrtslied vor der Wallfahrt, wenn man so sagen kann.
Letzte Bearbeitung: 18. April 2024
*