De profundis — Ps. CXXIX. (130)
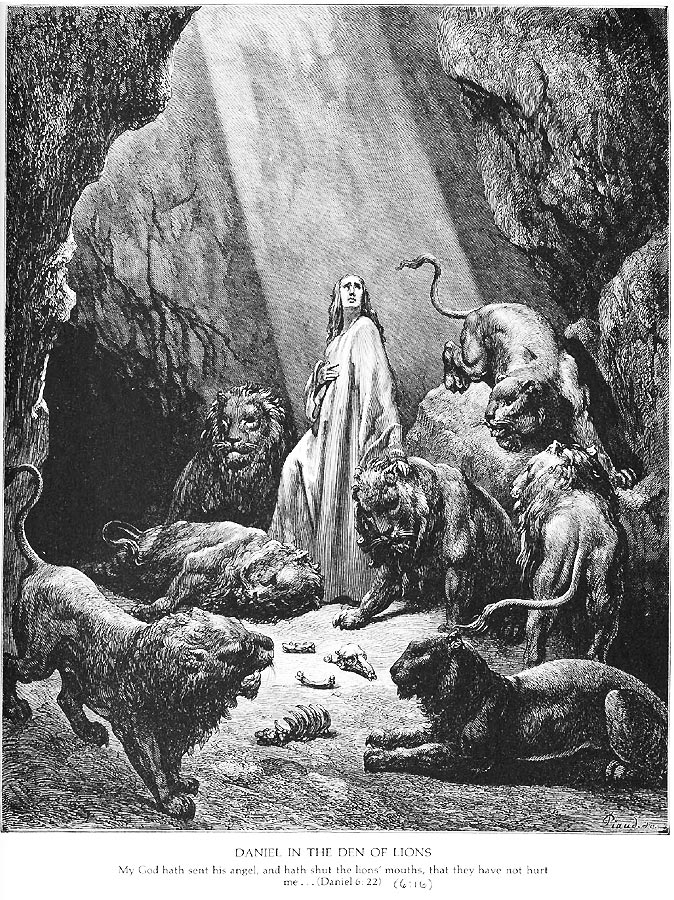
„Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu Dir“. (129; 1)
Dieser Psalm bedarf im Grunde keiner langen Erklärung oder Interpretation – er erschließt sich auch dem heutigen Christen unmittelbar und gehört in der Originalform oder in Nachdichtungen zum Grundbestand der Kirchenlieder aller christlichen Konfessionen. Im katholischen Bereich ist er allerdings stark auf den Gebrauch in der Totenliturgie eingeschränkt – vermutlich wegen eines verengten Verständnisses des Eingangsverses. Doch die Tiefen, von denen hier die Rede ist, haben nur bedingt etwas mit Tod, Grab und Unterwelt zu tun, sondern sie bezeichnen die allgemeine menschliche Situation der Gottesferne und Sündhaftigkeit in einer unerlösten Welt. Denn das unterscheidet Psalm 129 überaus auffällig von den vorangehenden Wallfahrtsliedern: Während diese sehr stark vom Alltagsleben und seinen Erfahrungen ausgingen, geht 129 theologischen Gedankenflügen nach – und verliert dennoch an keiner Stelle die „Bodenhaftung“.
Moderne Erklärer, die den Unterschied zwischen jüdischem und christlichem Heilsverständnis betonen, haben den Psalm konkret auf die verzweifelte Situation der Juden im babylonischen Exil bezogen. Diese Unheilserfahrung ist im Bewußtsein der Juden der zweiten Hälfte des Jahrtausends von Christus stets gegenwärtig, aber wie die zahlreichen allgemeinen Aussagen des Psalms sicher vermuten lassen, läßt sich seine Aussage keinesfalls auf einen derartigen geschichtlichen Rückblick oder die Verarbeitung historischer Erfahrung beschränken: Hier geht es um die menschliche Situation insgesamt.
Im Prinzip wird diese Situation in Psalm 129 bereits ebenso gesehen, wie die Christen sie auch sehen – insbesondere in den letzten Versen hört man schon (wie ähnlich auch in 41,12 und und 115) das „unruhig ist meine Seele, bis sie ruhet in Dir“ des Augustinus. (Conf. 1,1) Alles ist auch hier schon ausgerichtet auf die endgültige Erlösung, insofern hat dieser Psalm auch einen starken messianischen Charakter.
Kann man dann noch von einer „unerlösten Welt“ sprechen?. Nun, wenn auch die Welt als solche schon erlöst und die Herrschaft Satans gebrochen ist, so hat die Seele jedes lebenden Menschen doch ihren Weg zur Erlösung noch zu Ende zu gehen – abgeschlossen ist da noch gar nichts. (Vielleicht ist es dieser mahnende Aspekt, der Psalm 129 seine besondere Rolle in der Totenliturgie eingebracht hat). Und deshalb ist es auch nicht zufriedenstellend, wenn viele deutsche Übersetzungen den letzten Vers wiedergeben mit „Er wird Israel erlösen von all seinen Sünden“.
Das klingt doch sehr nach ferner Zukunft – aber so haben es die Juden nicht verstanden. Das vorchristliche Hebräisch hat ein anderes Zeitverständnis als die meisten westlichen Sprachen und auch das moderne Hebräisch. Die alte Sprache verwendet hier eine Zeitform, die vor allem die Unabgeschlossenheit eines Vorganges betont – der schon andauert, aber erst in Zukunft abgeschlossen sein wird. Gottes Erlösungshandeln begleitet die Menschen schon seit der Zeit ihrer Erlösungsbedürftigkeit, es wurde besiegelt in den (stets von Blutopfern) begleitetn Bundesschlüssen Jahwes mit seinem Volk und ebenfalls blutig gleichsam „ratifiziert“ im Kreuzesopfer, das seitdem unblutig immer wieder erneuert wird – bis die Erlösung in einer neuen Welt ohne Sünde und Tod ihren Abschluß finden wird. In dieser Perspektive hat das Futur seine Berechtigung.
Zusammen mit den in der Tonlage ähnlichen Psalmen 6, 31, 37, 50, 101 und 142 wird Psalm 129 unter die Bußpsalmen gezählt
Letzte Bearbeitung: 19. April 2024
*