Memento Domine David — Ps. CXXXI. (132)
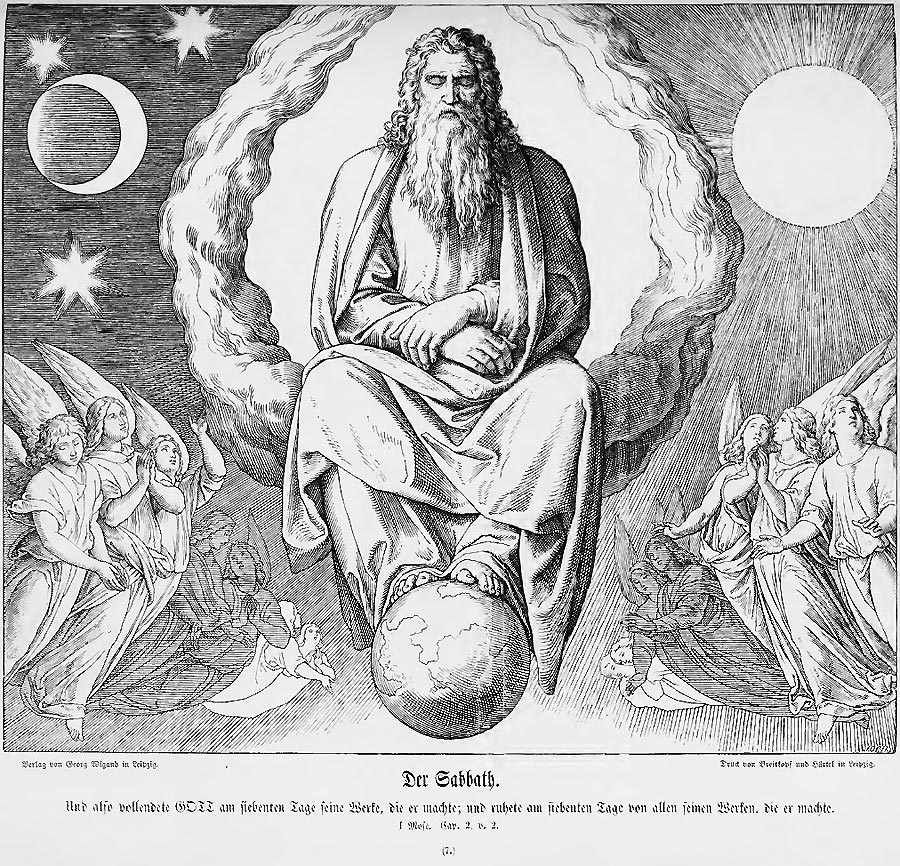
„Das ist für immer der Ort meiner Ruhe.“ (131; 14)
Auf den kürzesten Stufen- oder Wallfahrtspsalmen folgt der mit 18 Versen längste in der Reihe. Im Zentrum des Liedes steht die Erinnerung an David, der den Zionsberg als den vom Herrn für sich beanspruchten Wohnsitz erkannte und (zum Lohn dafür?) vom Herrn „Auf ewig“ zum Herrscher des auserwählten Volkes und zum Garanten seiner Wohlfahrt bestimmt wurde. Diese Hauptlinie wird jedoch nicht gerade durchgezogen, sondern in mehrfachen Windungen und Brechungen ausgeführt. In diesem Gedankengang lassen sich im wesentlichen vier Stationen voneinander unterscheiden.
Die erste (Verse 1 – 5) richtet sich ausdrücklich an Jahwe selbst, er möge sich an den Schwur Davids erinnern, nicht zu rasten und zu ruhen, bis er ein Ruheplatz für den Herrn und eine Stätte zu dessen Verehrung gefunden hat. Zusammen mit der Erinnerung an den Antwortschwur des Herrn, der – das ist eine weitere Station – in den Versen 11 – 13 wiedergegeben wird, verleiht das dem ganzen Lied den Charakter einer flehentlichen Bitte, die man so zusammenfassen könnte: Herr, David und wir als seine Erben haben unseren Teil der Abmachung erfüllt und den Tempel – zu dem wir jetzt wallfahren oder in dem wir jetzt beten – als Ort Deiner Ruhe errichtet. Nun erfülle auch Du Deinen Teil!
Die Notsituation – das wäre dann eine weitere Station – aus der heraus eine solche Bitte, ein solcher Anspruch vorgetragen wird, ist nicht ausgesprochen, aber Vers 10 gibt einen Hinweis: Der Gesalbte das Herrn – darunter muß man wohl die letzten Könige Israels verstehen – sieht sich von Gott verlassen, das Land, der Thron und der Tempel sind in höchster Gefahr. Und Vers 12 gibt einen weiteren Hinweis: Das Versprechen Jahwes war an die Bedingung gebunden: Wenn Deine Söhne diesen Bund einhalten … Und die Gottesfürchtigen im Volk waren sich immer bewußt, daß allzu viele Nachkommen Davids diese Bedingung eben nicht erfüllten, sondern auf vielfache Weise dagegen verstießen: Durch unmoralischen Lebenswandel, durch Mißachtung der Armen und Ausbeutung der Schwächeren, am schlimmsten aber: durch Opfer vor falschen Göttern. Damit wird die in den Versen 11 – 13 vorgebrachte Beteuerung der Bundestreue selbstkritisch stark relativiert. - so verlangt es das Dogma des Tun-Ergehens-Zusammenhanges. Und dieses Dogma wiederum beruht auf dem festen Glauben an die Gerechtigkeit Gottes.
Diese Gerechtigkeit verlangt jedoch nicht nur, daß der Herr die Sünden seines Volkes bestraft, sie verlangt auch daß der Herr letztlich seinem Versprechen treu bleibt und Israel nicht auf immer fallen läßt, wie das in Psalm 88 bereits ausdrücklicher und ausführlicher als hier ausgesprochen ist. Und so kann hier mit Vers 13 ein vertrauensvoll in die Zukunft blickender Schlußabschnitt beginnen: Gott Steht zu seinem Wort – er wird nicht auf ewig zürnen.
Bei diesem Weg durch die verschiedenen Teile des Psalms sind nun vier Verse (6 – 9) unter den Tisch gefallen, deren Verständnis sich nicht auf den ersten Blick erschließt. Der Ortsname Jaar – heute wohl Kirjat Jearim – erinnert jedenfalls an die ziemlich verworrene Geschichte der Rückkehr der von den Philistern entführten Bundeslade in die Hände Israels (1. Samuel 6 und 7), und wenn das Lied der Wallfahrer hier aus dem Berichtston der fünf ersten Verse mit dem Gelöbnis Davids in die Wir-Rede übergeht, steht das wohl dafür, daß sie sich in diese Geschichte einfügen, in ihrer Wanderschaft noch einmal den Weg Lade und die Erbauung des Tempels nacherleben und so das Erbe Davids beanspruchen.
Schwieriger ist die Deutung des Ortsnamens Ephrata in diesem Zusammenhang. Es gibt keinen biblischen Bericht, der die Bundeslade in Verbindung mit Ephrata bringt, das wohl weniger eine bestimmte Stadt, sondern eine kleine Region südlich von Jerusalem bezeichnet, das Stammland der DAviden. Mit dem „Wir hörten von seiner Lade in Ephrata“ wird also ein weiteres Mal der Bezug zu David hergestellt, dessen erste Aufgabe es doch war, die entführte Bundeslade wieder zu gewinnen und dem Herrn einen würdigen Tempel zu errichten. Aber da ist noch ein weiterer Bezug, der erst aus der Perspektive des Neuen Bundes wirklich sichtbar wird: Der Hauptort dieser Region war Bethlehem, das Haus des Brotes, und – dank der von Kaiser Augustus angeordneten Volkszählung – Geburtsort Jesu von Nazareths.
Das eröffnet den Raum für vielfältige fromme Gedanken und Spekulationen. Wir wissen, daß das spätjüdische und frühchristliche Denken eine große Vorliebe dafür hatte, heilsgeschichtliche Zusammenhänge durch Erzählungen wiederzugeben, die sich der Bilder von Kontinuität bestimmter Gegenstände oder Orte bedienten. Das Holz des Kreuzes des Erlösers kam nach einer dieser Erzählungen (im Nikodemus-Evangelium) von einem besonders prächtigen Baum, den Salomo für den Bau seines Tempels fällen ließ, dort aber nicht nutzen konnte, weil der Stamm sich jeder Verwendung entzog. Denn dieser Baum stammte von einem Sprößling des Lebensbaumes, den Adams Sohn Seth im Paradies erhalten hatte, und war allein dazu bestimmt, die Frucht der Erlösung zu tragen, wenn er dereinst erneut eingepflanzt würde: Auf dem Berg Golgatha, über dem Grab von Stammvater Adam.
Vielleicht gab es zur Zeit der Entstehung dieses alttestamentlichen Pilgerliedes eine fromme Erzählung, die auf ähnlich allegorische Weise Bethlehem Ephrata mit der Lade des Bundes verknüpfte, und jedenfalls trägt die Gottesmutter Maria in der lauretanischen Litanei den Titel „Foederis Arca“, mit dem in der Vulgata die Bundeslade bezeichnet wird.
Letzte Bearbeitung: 20. April 2024
*