Confitebor tibi Domine — Ps. CXXXVII. (138)
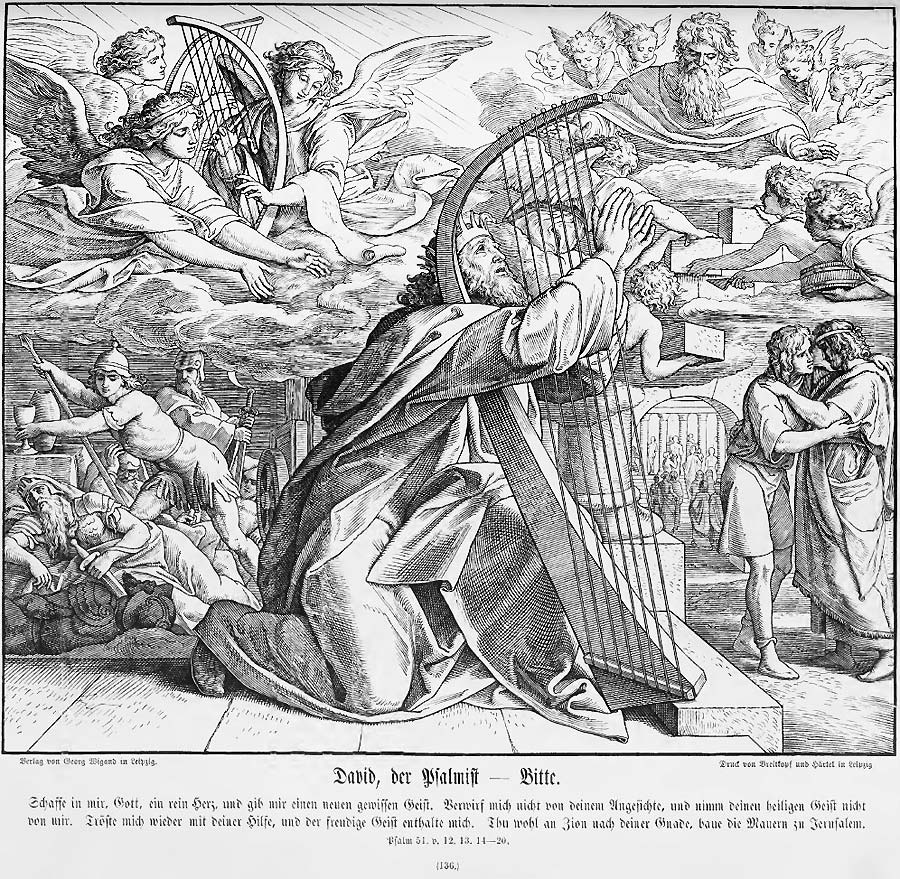
„Ich will Dir danken aus ganzem Herzen“ (137; 1)
Psalm 137 ist ein Dankgebet nach bestandener (Kriegs-)gefahr. Die traditionelle Zuschreibung an David ist wie stets nicht belegt, aber auch kaum widerlegbar. Jeder König oder Heerführer konnte nach einer einer gewonnenen Schlacht so sprechen. Der Aufbau in drei inhaltlich aufeinander aufbauenden und gleichzeitig unterschiedliche Perspektive einnehmenden Abschnitten zeugt jedenfalls von einer bereits hoch entwikkelten Dichtkunst und Frömmigkeit.
Im ersten Abschnitt (1 – 3) dankt der Sänger dem Herrn für die Erfüllung einer in schwerer Not ausgesprochenen Bitte. Was für eine Notlage das war, wird (hier) noch nicht ausgesagt, aber V. 3 deutet an, daß der ganze Mensch, Leib, Leben und Seele, von dieser Gefahr bedroht waren. Wo sonst steht: „Ich will Dich vor dem ganzen Volke preisen“, heißt es hier: „Im Angesicht der Engel will ich Dir lobsingen“ – könnte darauf hindeuten, daß der königliche Beter dieses Gebet im Tempel selbst verrichtet, abseits von allem Volk, als Teil einer feierlichen Dankliturge möglicherweise.
Gestützt wird diese Vermutung – mehr als eine Vermutung ist es natürlich nicht – durch den zweiten Abschnitt (4 – 6), der eine gleichsam „königliche“ Ebene einzunehmen scheint: Der siegreiche König oder Heerführer, der soeben einen feindlichen König besiegt hat, fordert die Könige der benachbarten Völker – Israel sah sich stets ringsum von Feinden umgeben – auf, diesen Sieg als Zeichen der Größe von (Israels) Gott wahrzunehmen, sich dessen Verehrung anzuschließen und vom Kampf gegen das Bundesvolk abzulassen. Bemerkenswert ist hier, wie die königlichen Feinde und Freunde Israels nach dem vertrauten Schema der Hochmütigen und der „Niedrigen“ eingeteilt werden: Auch mächtige Könige können in die Kategorie der „Niedrigen“ fallen, wenn sie nämlich Jahweh demütig als Gott anerkennen.
Ein marxistisch inspirierter Zweig der modernen Universitätstheorie neigt dazu, die in vielen Schriften des Alten Testaments getroffene Entgegensetzung von „hochmütigen Mächtigen“ und „armen Schwachen“ rein soziologisch zu lesen und in ein Klassenkampfschema einzupassen. Daran ist soviel richtig, daß der Mißbrauch ökonomischer Macht zuungunsten der kleinen Leute auch in der Gesellschaft Israels ein dauerndes Thema war und auch in der heiligen Schrift des alten Testaments angeprangert wird. Aber oft sind die selig gepriesenen Armen und Kleinen eben nicht die Bettler an den Wegen und Zäunen, sondern die „Armen im Geiste“, die ihren Platz in der Weltordnung und vor allem gegenüber Gott dem Herrn kennen und dementsprechend leben.
Nach dem durchaus geistig geleiteten Blick auf die weltlichen Dinge in den Versen 4 – 6 wendet sich die Aufmerksamkeit des Beters in den abschließenden Versen 7 und 8 wieder spirituellen Dingen zu – ohne dabei die große Welt mit ihren Herausforderungen außer Acht zu lassen. Doch Hauptthema dieser beiden Verse ist das Verhältnis des Dichters und des Menschen allgemein zu Gott, unter dessen Schutz er sich geborgen weiß – auch in schwierigen Situationen, auch gegenüber anstürmenden Feinden. Das abschließende Vertrauensbekenntnis endet wie schon öfter damit, daß der Beter seinen Herrn und Gott über die Kluft zwischen Schöpfer und Geschöpf hinweg an seine „Vaterpflichten“ erinnert: Verachte nicht das Werk Deiner Hände!
In der engen Verbindung weltlicher und spiritueller Motive und in der vertrauensvollen Hinwendung zum Schöpfergott gibt Psalm 137 ein gutes Beispiel für die Gebetshaltung frommer Juden gegenüber ihrem – und unserem Gott; eine Gebetshaltung, die die Christen vollständig übernahmen und die ihnen so lange und so weit als selbstverständlich galt und gilt, wie die Psalmen ihr Hauptgebet waren. Von daher ist Psalm 137 geradezu der Prototyp eines Dankgebetes, in dem der Beter sich von den Widrigkeiten und Nöten des irdischen Lebens ausgehend dem Herrn zuwendet und all sein Vertrauen auf den setzt, der alles geschaffen hat und dem er alles verdankt: Dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden.
Letzte Bearbeitung: 20. April 2024
*