Eripe me, Domine — Ps. CXXXIX. (140)
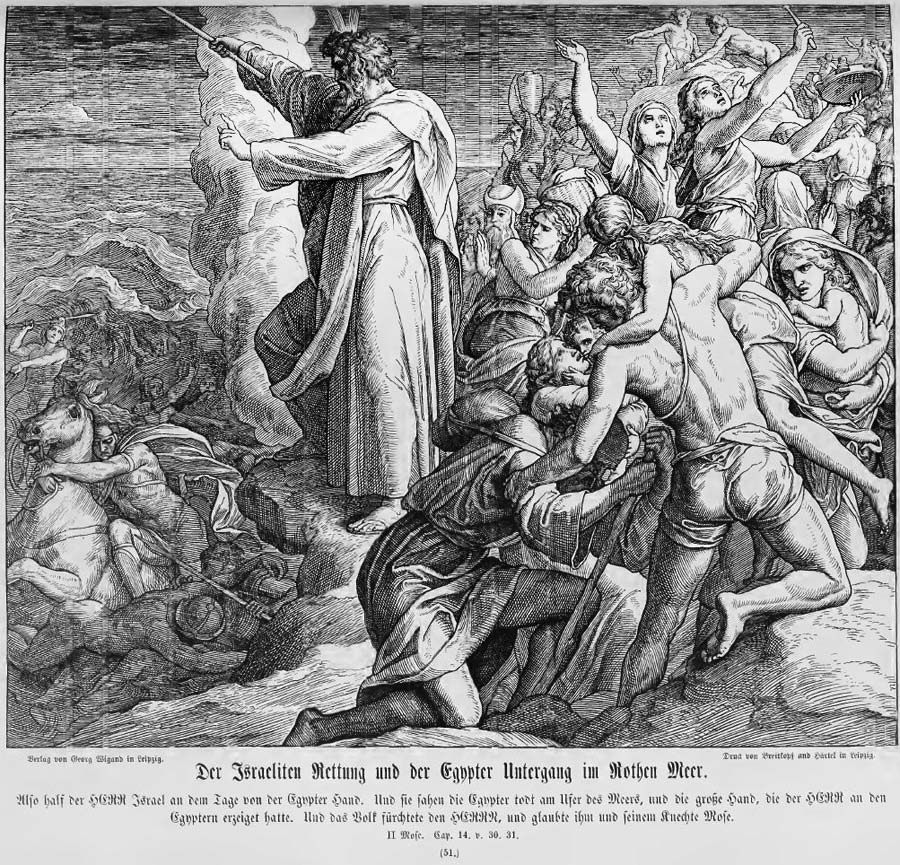
„Behüte mich Herr vor der Hand der Bösen, befreie mich von ungerechten Menschen“. (139; 5)
Mit Psalm 139 beginnt eine Reihe von Bittpsalmen, in denen ein frommer Beter um Errettung aus einer (oder mehreren) als überaus mißlich empfundenen Situationen bittet. Diesen Psamen ist gemeinsam, daß sie zu einem großen Teil aus Versen oder Zitaten vorhergehender Psalmen bestehen. Das hat zu der Annahme geführt, daß sie zu einer Zeit entstanden sind, als der Großteil der Psalmen bereits fest stand, vielleicht sogar erst zum Zeitpunkt jener vermuteten „Endredaktion“ um das 4. vorchristliche Jahrhundert, in der das Buch der Psalmen seine bis auf den heutigen Tag überlieferte Gestalt annahm. Daß es eine solche „Endredaktion“ gegeben hat, erscheint von der Sache her unbezweifelbar – aber über ihre näheren Umstände, über die „Redakteure“ und ihre Zielsetzungen gibt es zwar viele Vermutungen, aber nicht die geringste gesicherte Information.
Angesichts des alles in allem doch begrenzten Grundvorrats an Motiven und Formulierungen der Sprache der Psalmen erscheint es jedenfalls in vielen Fällen kaum entscheidbar, ob ähnlich klingende Verse tatsächlich „Zitate“ darstellen oder nur eine weiteres Aufscheinen eines solchen „Grundmotivs“. Die übereinstimmende Zuschreibung dieser Psalmen an David läßt uns jedenfalls daran zweifeln, daß es sich dabei um bewußte Neuschöpfungen gehandelt hätte, denen durch diese Zuschreibung der Anschein der Authentizität verliehen werden sollte. Eher erscheint es denkbar, daß hier eine Redaktion „Material“ unterschiedlicher Herkunft und Alters mehr oder weniger glücklich „verarbeitet“ hätte, das bei der bisherigen Zusammenstellung unberücksichtigt geblieben war – das man aus Ehrfurcht vor der Überlieferung aber auch nicht aufgeben wollte.
Jedenfalls weisen die Psalmen von 139 bis 143 sprachlich und inhaltlich beträchtliche Unterschiede auf, die es nicht wahrscheinlich erscheinen lassen, sie alle auf einen gemeinsamen Ursprung zurückzuführen. Eine gewisse Besonderheit von139 kann man darin sehen, daß die Notlage, aus der heraus der Beter den Herrn anspricht, in gar keiner Weise spezifiziert wird. Es geht nicht um einen bösen Nachbarn, der den Beter mit einer falschen Anklage vor Gericht zerrt, es geht auch nicht um das Mobbing der Mißgünstigen, die dem Frommen das Leben schwer machen, und auch nicht um Feinde von außen, die den Frieden des Landes bedrohen – Thema von 139 ist ganz allgemein die Schlechtigkeit der Menschen, von der sich der Fromme umgeben und bedroht sieht. In drei Strophen wird diese Schlechtigkeit aus verschiedener Perspektive und wie es scheint auch mit zunehmender Intensität dargestellt.
Mit Psalm 139/140 beginnt eine Folge von 5, vielleicht auch 6 Psalmen, die eine Reihe von Gemeinsamkeiten aufweisen, so daß man sie als ein eigenes Unterkapitel des vierten Buches auffassen kann. Alle 5 (oder auch 6, je nach Zuordnung) sind intensive Bittgebete, die nach dem gleichen Muster aufgebaut sind: Beschreibung einer Notlage und zumeist auch der sie verursachenden Übeltäter; Bitte um Errettung, die mit der Ablegung eines „Vertrauensbekenntnisses“ und einer Verwünschung der Bösen, Übeltäter oder Gottlosen verstärkt wird. Alle diese Psalmen sind relativ kurz und bestehen aus nur wenigen oft nur drei-versigen Strophen. Sie werden sämtlich traditionell David als Urheber zugeschrieen, und wenn auch diese Zuschreibung wie stets nicht belegbar ist, lassen doch das relativ schlichte Welt- und Gottesbild vor allem der ersten dieser Lieder vermuten, daß sie auf älteste Zeit zurückgehen beziehungsweise unter Rückgriff auf sehr altes Material zusammengestellt worden sind.
Von daher bieten sie dem Verständnis des christlichen Beters im 21. Jahrhundert zunächst einmal beträchtliche Verständnisschwierigkeiten – die sich andererseits gerade in diesen Jahren seit Beginn des 3. Jahrtausends dadurch abmildern lassen, daß wir eben nicht mehr in einer zumindest dem Anspruch nach vom Glauben geprägten Umwelt leben, sondern uns ebenso wie die Juden der Frühzeit von einer Vielzahl feindlicher Mächte und Gewalten umgeben und bedroht sehen müssen.
Auf Psalm 139/140 angewandt bedeutet diese Einsicht, daß es nur wenig Phantasie braucht, um hinter der Liste der in den beiden ersten Strophen (Verse 2 – 6) aufgezählten „Frevler“ deren aktuelle Gegenstücke zu erkennen – von der in den Medienapparaten propagierten Glaubens- und Sittenlosigkeit unter dem Banner des „Fortschritts“ bis zur globalen Kriegstreiberei Die Parallele endet da, wo der Beter in der 3. Strophe eine Glaubenszuversicht ausspricht, die uns heute vielfach nicht mehr erreichbar scheint, und dann in der 4. Strophe zu Verwünschungen der Bösen und der Bosheit greift, die uns Gegenwärtigen, da „Dialog“ mit allen und über alles angesagt ist, ganz und gar unzulässig, ja sogar skandalös erscheinen.
Konsequenterweise hat denn die Neufassung des Stundenbuches auch die 4. Strophe von 139 komplett gestrichen und damit den Glauben an die göttliche Gerechtigkeit, der im Christentum zwar sublimiert, aber keinesfalls „abgeschafft“ worden ist, aus dem offiziellen Gebetbuch der Kirche getilgt. Ein klägliches Bild – an dem allerdings abzulesen ist, daß die im Pontifikat Bergoglios offen praktizierte Abkehr von alten Glaubensgewissheiten keine Neuerfindung des argentinischen Jesuiten ist, sondern ihre Wurzeln unmittelbar auf die mit dem II. Vatikanum und der Liturgiereform so dramatisch beschleunigte Abkehr von der Lehre der Väter zurückgeht.
Letzte Bearbeitung: 20. April 2024
*