Domine exaudi orationem meam — Ps. CXLII. (143)
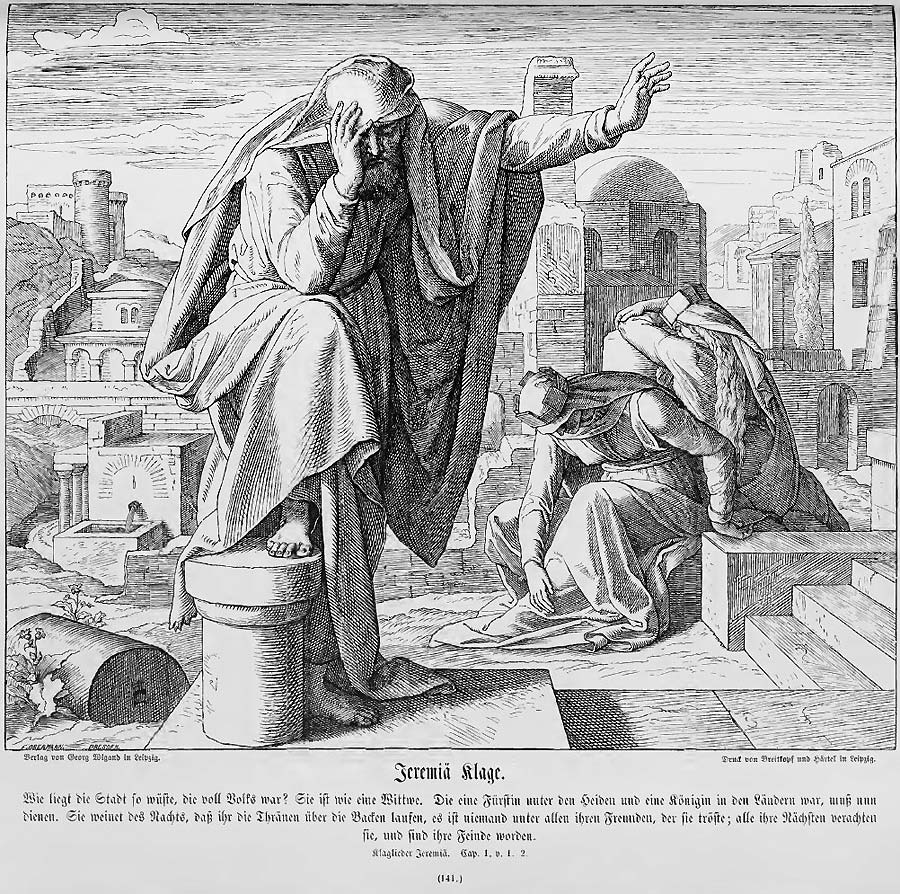
„Verbirg Dein Antlitz nicht vor mir, damit ich nicht werde wie Menschen, die schon begraben sind.“ (142; 7)
Psalm 142 schließt von Situation und Stimmung her unmittelbar an den Vorgänger an. Auch hier sieht sich der Beter – traditionell wird der Psalm David zugeschrieben – in einer nachgerade ausweglosen Notlage, der er nicht mehr entgegenzusetzen weiß als sein unverbrüchliches Vertrauen in die Weisheit und den Rettungswillen Gottes. Und am Schluß (V. 11) greift 142 den gleichen Gedanken auf, der auch bereits am Ende von 141 (V. 8) eine so große Rolle spielt: Nicht (nur) um des Beters willen soll der Herr dessen Not wenden, sondern zur Ehre seines Namens, zum Erweis seiner grenzenlosen Macht.
Auf den ersten Blick könnte man 142 daher fast für eine überarbeitete Fassung des Vorangehenden halten. Wie dieser besteht er aus zwei Strophen, die im einen Fall jeweils vier, im anderen jeweils 6 Verse umfassen. Bei beiden Psalmen liegt in der ersten Strophe der Schwerpunkt auf der Schilderung der Notlage, während im Mittelpunkt der zweiten Strophe jeweils die Bitte um Errettung steht – womit beide Psalmen freilich einem auch in vielen anderen Fällen vorzufindenden allgemeinen Muster folgen.
Wenn man beim Vergleich der beiden Psalmen dann genauer hinschaut, fällt ein Unterschied ins Auge: 141 bleibt in allen seinen Aussagen auf einer beschreibenden Ebene: Die Erfahrungen und die Erwartungen des Beters stehen im Mittelpunkt. In 142 wird diese persönliche Ebene zwar nicht aufgegeben, aber an mehreren Stellen überschritten und ins Allgemeine gewendet. Von daher ist es leicht nachvollziehbar, daß die Überlieferungstradition 141 in einer konkreten Situation aus dem Leben Davids – nämlich dem Aufenthalt in den Höhlen von Engaddi – verorten zu können glaubte, während sie sich bei 142 mit der örtlich und biographisch unbestimmten Angabe „von David“ begnügt.
Das ist aber nicht der einzige Punkt, in dem Psalm 142 gerade in seiner Allgemeinheit über 141 hinausgeht. Schon der zweite Vers der ersten Strophe spricht es in seinem: „Denn keiner, der lebt, ist gerecht vor Dir“ aus: jeder Mensch ist gemeint, was hier gesagt wird, ist nicht Geschichte, sondern, geht alle an. Vergleichbare Aufblicke in die allgemeine Situation des frommen, aber immer wieder fehlgehenden Menschen finden sich in V. 3, 5, 7 und 10. Der Beter, dessen Gedanken hier zum Ausdruck kommen, ist nicht der von seinen Feinden gehetzte und in die Höhle geflohene gotterwählte König des (vielleicht) 11. vorchristlichen Jahrhunderts, sondern Geschöpf, das sich seiner Unzulänglichkeit, seiner Hilfs- und Erlösungsbedürftigkeit bewußt ist. In diesem Zusammenhang ist besonders auffällig, daß ein Motiv, das uns bei einigen anderen Psalmen (insb. 17; 21ff, aber auch 25, 29 oder 95) aufgefallen ist, hier gänzlich fehlt: Von dem, was uns heute als Selbstgerechtigkeit erscheinen mag, von der Überzeugung, durch das möglichst wörtliche Einhalten des Gesetzes vor dem Herrn gerechtfertigt zu sein, ist hier keine Spur. In den Versen 8 und 10 taucht sogar ein Gedanke auf, der ahnen läßt, daß der Verfasser dieses Psalms die Gesetzesfrömmigkeit alleine für unzureichend hält, wenn er betet: Zeige mir den Weg, den ich gehen soll, oder „lehre mich, deinen Willen zu tun“ – als ob nicht dieser Weg und dieser Wille im „Gesetz“ der Torah nicht längst klar und deutlich vorgezeichnet wären.
Anklänge an diese Haltung finden sich freilich auch an anderer Stelle – insbesondere auch in dem dem „Lob des Gesetzes“ geweihten Psalm 118, der etwa in seinen Abschnitten „Dalet“ (25 – 32) oder „Taw“ (169 – 176) anklingen läßt, daß ohne die helfende Hand Gottes auch der Gutwillige nicht im Stande ist, den Weg des Gesetzes ohne Irrtum zu gehen. Aber auch da wird an keiner Stelle so deutlich wie hier, daß diese göttliche Gnade eine Grundbedingung dafür darstellt, den Willen des Herrn zu erfüllen. Und so ist es wahrscheinlich kein Zufall oder gar Versehen des Dichters, der diesem Psalm seine endgültige Form gegeben hat, daß von den starken Worten, die Psalm 118 für das „Gesetz“ gefunden hat, hier nur das relativ schwache vom „Weg“ auftaucht – zu dessen Befolgung es der ständigen Anleitung durch den Geist Gottes (ruah) bedarf – zu dessen Bezeichnung hier übrigens die eindeutig männliche Form des von der feministischen Theologie gerne mißdeuteten Wortes genutzt wird. Wenige Stellen in den Psalmen sind so weit von der in anderen Passagen anklingenden Selbstgerechtigkeit entfernt und kommen dem Begriff von der „Gefallenheit“ des Menschen so nahe, der zu seiner Rettung des ständigen Gnadenhandelns des Erlösers bedarf.
Diese Nähe zur christlichen Anthropologie und zu christlichen Auffassungen vom Handeln Gottes ist kein Zufall. Nach Ansicht vieler moderner Schrifterklärer gehört Psalm 142 abweichend von vielen anderen „Davidspsalmen“ zu den jüngsten des ganzen Buches. Dieser Befund stützt sich vor allem darauf, daß die meisten seiner Verse mehr oder weniger wörtliche Zitate aus anderen Psalmen darstellen, also wohl nach diesen niedergeschrieben worden sind und Psalm 142 damit in gewisser Weise die Stellung einer Zusammenfassung, einer Summa des ganzen Psalters einnimmt. Jedenfalls ist er in seinem ganzen Geist weit von der manchmal mechanisch anmutenden Repetition des Tun-Ergehens-Zusammenhanges entfernt, die viele anderen Psalmen kennzeichnet, und nähert sich dem Glauben an einen gnädigen Gott, der nicht nur als der lang erwartete Messias das Schicksal seines Volkes Israel wenden wird, sondern der ganzen Menschheit und der ganzen Schöpfung eine neue Perspektive eröffnet. Diese messianischen Vorstellungen fanden ihren wirkungsmächtigen Ausdruck im 4. und 3. vorchristlichen Jahrhundert – also eben in der Zeit, in der Psalm 142 entstanden sein dürfte und das Buch der Psalmen seine endgültige Form erhielt.
Psalm 142 kann zwar nicht wirklich zu den messianischen Psalmen gezählt werden – aber der Geist der Erwartung des kommenden Heilands der Seelen ist in ihm schon überaus deutlich spürbar.
Letzte Bearbeitung: 22. April 2024
*