Benedictus Dominus Deus meus —
Ps. CXLIII. (144)
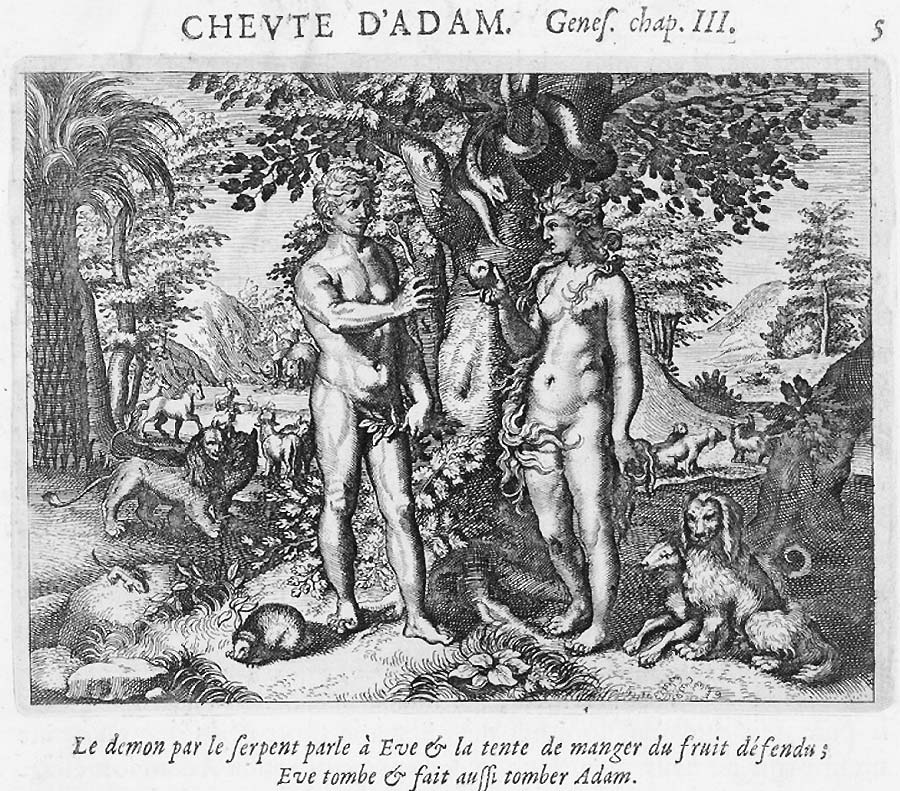
„Herr, was ist der Mensch, daß Du seiner achtest?“ (143; 3)
Kein reines Bittgebet, sondern in weiten Teilen ein Lob- und Dankgesang, in dem sich der Dank für die Wohltaten des Herrn gegenüber seinem Volk und dessen Kindern mit den Bitten und in der Gewissheit mischen, daß diese Wohltaten auch jetzt und in Zukunft gewährt werden.
Die Zuschreibung von Psalm 143 an David ist wie in allen diesen Fällen durchaus zwiefelhaft, aber der Psalm selbst ist von seinem Inhalt so sehr königlichen Angelegenheiten zugewandt, daß es schwer fällt, seinen Ursprung anders als im Zusammenhang mit einem königlichen Auftritt, vielleicht innerhalb einer auf den König bezogenen Liturgie, zu verorten. Daß er auch nach dem Verlust des Königtums weiter gebetet und in den Psalter aufgenommen wurde, ist wohl dem Umstand zu verdanken, daß er die Stellung des Königs gegenüber seinem Gott in einer Weise ausdrückt, die dem ganzen Volk Anteil an dieser hervorgehobenen Stellung zuschreibt: Durch seine Beziehung zu Jahweh wird ganz Israel zu einem königlichen Volk.
Der erste Teil, die erste Strophe (Verse 1 – 4) enthält ein weit ausholendes Dankgebet, mit dem der königliche Beter dem Herrn für die ihm verliehene hohe Stellung und die ihm bisher zuteil gewordenen Wohltaten dankt. Dieser Dank mündet in den Ausdruck der Verwunderung darüber, daß der große Jahweh sich überhaupt dazu herabläßt, die menschlichen Angelegenheiten zu beachten. Von der Funktion her kann man diese Verse als eine Art Captatio Benevolentiae betrahten: Der Beter macht sich klein um die Wirkung seines Werbens um das Wohlwollen seines Gottes, von dem er Hilfe in einer schweren Notlage erbittet, zu verstärken. Welcher Art diese Notlage ist, wird zunächst in keiner Weise angesprochen. Die poetischen Ausdrücke der Verse 5 – 7 verweisen auf Standardbilder, mit denen die Macht Jahwes versinnbildlicht wird, ein Macht, die die Berge Feuer speien läßt und sogar stark genug ist, um den gewaltigen Wassern der alles verschlingenden Urflut zu begegnen. Als einziger – möglicherweise – konkreter Hinweis bleibt die Erwähnung der „Fremden“, in deren Hand sich der König und mit ihm sein ganzes Volk gegeben sieht. Der Hinweis hat Gewicht, wird er doch am Ende der nächsten Strophe fast wörtlich wiederholt. Dabei ist auffällig, daß die Fremden dem König und seinem Volk anscheinend nicht mit Waffengewalt zusetzen, sondern mit abgrundtiefer Verlogenheit: Alles, was ihr Mund sagt, ist gelogen, und mit ihrer Rechten schwören sie Meineide. Der Meineid ist nach anderen Psalmen zu urteilen eine Untat, die eher im innergesellschaftlichen Verhältnis ihre Zerstörungskraft entfaltet. Wenn sie hier in einem Atemzug mit „Fremden“, Nicht-Volkszugehörigen genannt wird, läßt das zusammen mit den Bildern der Verse 5 – 7 den Eindruck einer allumfassenden, von allen Seiten auf den Bedrohten einstürmenden Gefahr unbeschreiblicher Art entstehen.
Im Widerspruch zu den Bildern der ersten Strophe, die eine konkrete Kriegssituationr vermuten lassen, erscheint die Bedrohung hier als eine nachgerade metaphysische Kraft. Die Gefährdungen der Seele – prononciert in christlicher Perspektive gesprochen – dringen von allen Seiten auf den Menschen ein – auch von innen.
Noch vor dem Refrain, der die Errettungsbitte wiederholt, hat der Beter dem Herrn sein Danklied für die Gewährung seiner Bitten gewidmet. Das ist nicht außergewöhnlich: viele Psalmen sprechen auf diese Weise dem Herrn ihr unbedingtes Vertrauen für seine als sicher erwartete Hilfe aus. Allerdings stehen die inhaltlich entsprechenden Verse meist am Schluß eines Psalms und nicht wie hier bereits vor einer letzten Strophe. Tatsächlich kündigt sich mit dieser dritten Strophe hier ein Wechsel der Tonart und der Perspektive an, der einiger Erklärungsversuche bedarf. Doch zuvor ist noch kurz auf eine Eigentümlichkeit des die dritte Strophe abschließenden „Refrains“ einzugehen.
Der Refrain gibt Anlaß, einmal kurz auf die Problematik der Zählung der Verse einzugehen, die sich hier und an anderen Stellen jedenfalls nicht am Wortlaut der hebräischen Fassung orientiert, sondern gewisse Unschärfen aufweist. Während das „Alles, was ihr Mund sagt, ist gelogen, und mit ihrer Rechten schwören sie Meineide“ in der 2. Strophe einen Vers für sich bildet, stellt es in der dritten Strophe nur einen Teil des letzten Verses. Wir wissen nicht, nach welchen Kriterien die masoretischen Bearbeiter die Verse abteilten und zählten – aber es waren jedenfalls nicht die, die wir von den Versmaßen der griechischen und lateinischen Dichtung gewohnt sind. Und so kommt es wie hier in der dritten Strophe des öfteren zu schwer erklärbaren Einteilungen. Hier führt die genannte „Unschärfe“ dazu, daß daß die Strophe nur mit drei Versen gezählt wird – während von den Worten her genug „Material“ für eine Einteilung in vier Verse vorhanden wäre. Dabei läßt der Refrain im konkreten Fall keinen Zweifel daran zu, wo der Vers endet. In anderen Fällen, wo ein hilfreicher Refrain (oder ein „sela“) als Gliederungselement fehlt, ist man auf Vermutungen angewiesen. Wir wissen – zum Teil aus den Psalmenüberschriften selbst – daß die Psalmen gesungen wurden. Über die Art des Gesanges ist so gut wie nichts sicher bekannt. Es ist jedenfalls nicht auszuschließen, daß die Musik mit zu den genannten Problemen beigetragen hat.
Zurück zum angesprochenen Wechsel von Perspektive und Tonalität. Der hebräische Text besteht hier aus aneinander gereihten Stichworten, deren Beziehung unterschiedlich gedeutet werden kann. Diesen Stichworten nach ist von einer Gesellschaft die Rede, deren Menschen glücklich zu sein scheinen und die in Frieden und Überfluß leben. Hier hängt alles vom Verständnis des einleitenden Wortes „asher“ ab, das normalerweise ein Relativpronomen darstellt. Die Septuaginta und ihre Tradition beziehen das Folgende grammatisch durchaus begründbar auf die Gesellschaft der Lügner und Meineidigen. Der Gedanke wäre dann in etwa der, daß es diesen Frevlern eben deshalb so gut geht, weil sie ihre Mitmenschen übervorteilen und betrügen. Und erst im Schlußsatz des letzten Verses wird die rechte Ordnung der Dinge zumindest als Behauptung wieder hergestellt: „Doch wirklich glücklich ist nur das Volk, dessen Gott Jahwe ist“.
Diese Lesart erscheint nicht wirklich überzeugend: Das Bild der glücklichen Gesellschaft ist zu breit und zu liebevoll gezeichnet, um dann mit einem lapidaren Einwurf zum Trugbild erklärt werden zu können. Die hebräische Tradition deutet das einleitende „asher“ daher um und bezieht die in den Versen 12 – 15 gezeichnete Idylle auf das eigene Volk: „Unsere Söhne wie junge Bäume, unsere Töchter wie schlanke Säulen im Tempel…. Wohl uns, daß wir den wahren Gott haben!“ Das klingt sehr schön und passend, wirft aber ein anderes Problem auf: Da die fraglichen Verse praktisch nur aus Stichworten bestehen und keine Verben geboten werden, die etwas über die Zeitstufe oder den Realitäts-Modus aussagen, bleibt völlig offen, wird hier ein bestehender Zustand beschrieben, oder um einen künftigen glücklichen Zustand gebeten oder aber ein Segen erteilt, der einen solchen Zustand verspricht. Das traditionelle jüdische Verständnis entscheidet sich hier für die Möglichkeit, die Aufzählung als eine Ansammlung von Wünschen oder Bitten zu verstehen, und die meisten moderneren christlichen Übersetzungen schließen sich dem an.
Dieses Verständnis erscheint zumindest eingängiger als das von der Septuaginta und ihrer Tradition gebotene. Der Psalm ließe sich danach in folgender Weise gliedern: Anfang eine Huldigung des Herrn, die unverkennbare Züge einer captatio benevolentiae aufweist. Im Mittelteil eine Bitte um Gottes Hilfe in einer nicht näher bestimmter Notsituation, verbunden mit dem üblichen „vorauseilenden Dank“ für die als gewiss geglaubte Erhörung, und zum Abschluß eine Art Segenswunsch, der all das zusammenfasst, was der fromme Jude sich vom Leben erhoffen durfte: Eine glückliche große Familie, reiche Vorräte, fruchtbare und gesunde Viehherden und Friede auf allen Straßen und Wegen. Denn genau das ist, was der Herr Jahweh dem Volk, das ihm in Treue dient, verspricht und gewährt. Dabei kann es bei dieser Einteilung des Psalms offen bleiben, ob alle drei Teile von ein und demselben Beter – vielleicht sogar dem König – oder einer Betergruppe vorgetragen werden, oder ob der dritte Teil vielleicht einen besonderen Segensspruch darstellt, der im Rahmen einer Liturgie von einem Priester gesprochen wurde.
Für den christlichen Beter der Gegenwart bietet Psalm 143 trotz seiner textlichen Schwierigkeiten einen bemerkenswerten Einblick in eine Spiritualität, deren Gottergebung und Gottvertrauen einerseits ein Vorbild sein kann, andererseits aber auch in der Gefahr steht, mit Gott einen Handel machen zu wollen, um letztlich doch sehr diesseiteige Ziele zu erreichen. Nicht, daß es derlei Tendenzen im Christentum nicht auch gäbe...
Letzte Bearbeitung: 22. April 2024
*